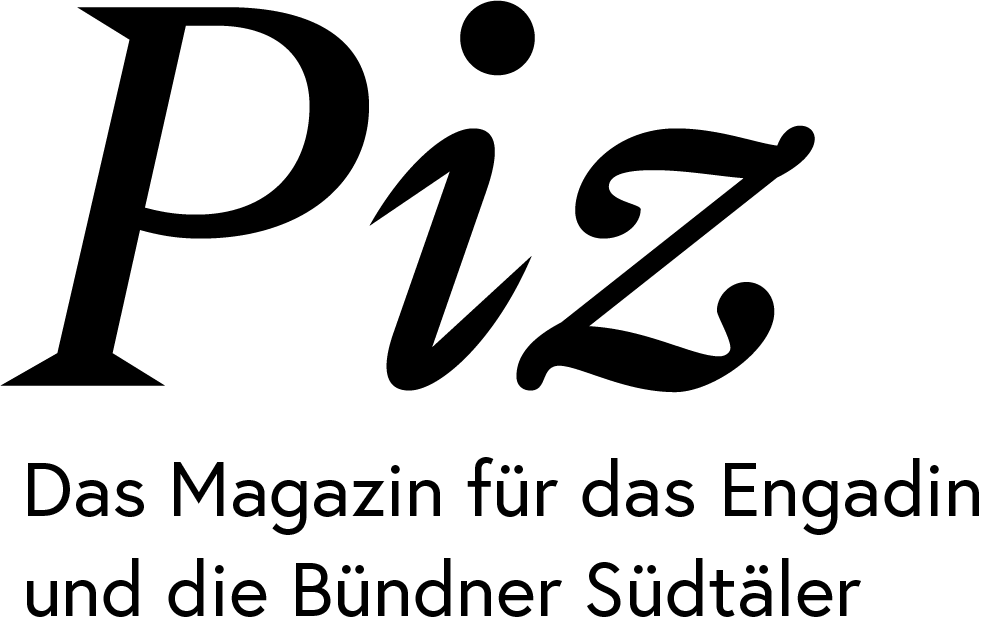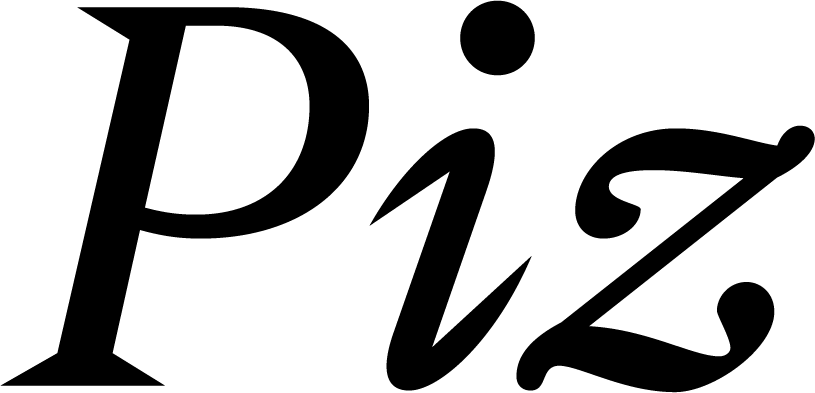Vor der Pieke ist es zappenduster
↑ Anita Weber, Geologin, begutachtet die Baustelle im Albula-Tunnel. «Herr, segne Streben, Schacht und Stollen, Bewahre uns vor Flut
und Brand. Herr, dem wir treu gehören wollen,
Du hast die Welt in Deiner Hand.»
So endet das Schichtgebet der Bergleute. Gewidmet ist es nebst dem Herrn der heiligen Barbara. Wo es knallt, ist die Barbara nicht weit. Als Schutzpatronin wacht die stets mit Turm und Kanonenrohr bewehrte Barbara über Bergbau, Artillerie und auch den Tunnelbau. Man findet sie bei jedem Portal im Eingang, meist in eine Nische eingebettet. «Aber meist hinter Gittern, damit sie nicht rauskann», sagt Anita Weber scherzend. Einmal im Jahr, am Barbaratag, dem 4. Dezember, wird sie rausgelassen und in den Tunnel getragen. «Da gibt es dann eine Messe mit Pfarrer und Barbara», erzählt die Geologin, «danach wird sie gewürdigt, geweiht und wieder zurück hinter Gitter gestellt, ehe die Mineure in die Knellen ziehen.» Lange Zeit war die heilige Barbara die einzige Frau, die im Tunnel zugelassen war.
Begrüssung am Hof
Auch heute sind Frauen im Tunnelbau selten anzutreffen. Eine dieser wenigen ist Anita Weber. Ich treffe sie auf ihrem Yak- und Ziegenhof am unteren Dorfrand von Domat/Ems, den sie seit einem Jahr bewirtschaftet. Hier eröffnet sich an diesem ungewöhnlich windstillen Herbsttag ein wohltuender Blick auf die sonnenverwöhnte Ebene. Wer vom Dorf herkommend vorbei am Kürbis- und Kartoffelfeld die Scheune betritt, findet sich vor einem Gefrierschrank wie- der, zur Linken einige Regale. Im Hofladen kann sich Laufkundschaft mit allerlei Gemüse, Yak-Fleisch, Käse oder Ziegenbratwürsten eindecken – und auch das Inkasso gleich selbst besorgen. Zur Rechten, mitten in der Remise, ein Wohnwagen. «Mein Büro», wird lachend erklärt, «und zugleich der einzige beheizte Raum auf dem Hof – und ich bin übrigens die Anita, das ist einfacher.»
«Einen Kaffee?» Anita führt durch den einstigen Kuhstall hinaus zu einem kleinen Tisch mitten in der prallen Vormittagssonne.
Ungewissheit als täglich Brot
«Vor der Pieke ist es zappenduster», heisst es in der Bergmannsprache. Im Stollen ist das Licht knapp, und Gewissheit gibt es erst recht nicht. Hier beginnt die Arbeit der Tunnelgeologin. «Es geht darum vorauszusagen, was kommen wird und was passieren kann; schätzen, Daumen lutschen», wie Anita es ausdrückt. Mit welchen Gesteinsschichten ist wann zu rechnen? Normalerweise folgen die Schichten einander in fixer Abfolge – müssen sie aber nicht. «Vielleicht wurde das Gestein durch eine Störung versetzt, oder das Gebirge wurde gefaltet.» Und wie ist die Beschaffenheit der aktuellen Schicht? Ist Wasser im Spiel? Am Ende muss die Geologin eine Annahme treffen. Darauf stützen die Ingenieure ihre Entscheidungen: Welche Sicherungs- klasse ist nötig, welcher Vortrieb wird gewählt, Sprengung oder Tunnelbohrmaschine?
«Der spannendste Moment ist es, wenn du in den Tunnel reingehst und anbohrst, dann kommt das Bibbern und es zeigt sich, ob die Prognosen stimmen. Vom Budget hängt ab, wie oft die Geologen im Tunnel sind, wie viele Testbohrungen gemacht werden. «Bei gutem Gebirge kann man das Risiko eher eingehen, es nicht so genau zu wissen», sagt die Geologin. Und klärt gleich auf: «Tunnelbauer mögen Stabilität – und damit festes Gestein.» Granit etwa kann nicht aufgeweicht werden, dann ist auch Wasser kein Problem, «es ist einfach lästig, wirst halt nass». Anders verhält es sich bei weichem Gestein, das ausgewaschen werden kann.
Es wird rasch klar, die einstige Orientierungsläuferin mag das Ungewisse, Unwegsame und die Herausforderung. «Ich hab’s gern, wenn mal was Spannendes kommt», sagt sie und fügt mit strahlenden Augen und dem kindlichen Tonfall der Begeisterung an: «Zum Beispiel Wasser!» Darf man natürlich nicht zu laut sagen, denn für die Baustelle wird es dann schwieriger. «Aber dann erwachst du, dann ist was los!»
Freiluftgeologie statt Bürobiologie
Während im Hintergrund die rund 70 Hühner müssig vor sich hin gackern, zeichnet Anita ihren Weg in den Stollen nach – ein Weg mit Wendungen. Dass die gebürtige Zugerin mit Jahrgang 1973 eines Tages rauhändigen Bergmännern im Berg- innern den Weg durch urzeitliche Gesteinsschichten weisen würde, war alles andere als vorgezeichnet. Von Kindsbeinen an waren es nicht etwa Steine, Berge oder Höhlen, die Anita in ihren Bann zogen, sondern das Lebendige, die Tiere: als junges Mädchen der obligate Traum vom eigenen Pony (sie versuchte auch mehrmals vergeblich, an Wettbewerben eines zu gewinnen), mit zwölf das erste Pferd in Pflege, während der Kantonsschule die erwogene Bäuerinnenschule ... «Eigentlich wollte ich Biologie studieren.» Bei der Berufsberatung stellte sich aber heraus: die Biologenarbeit spielt kaum mehr draussen, kaum mehr beim Leben selbst, sondern drinnen, meist im Labor oder im Büro. «Aber ich wollte raus.» Und Geologie beginnt auch heute noch da, wo sie sich abspielt: draussen.
Hörst du ein Rieseln?
Eine Geologin ist normalerweise nach der erfolgten Sprengung oder während der Bohrarbeiten im Tunnel, um sich ein Bild vom neu erschlossenen Gebirge zu machen. Ausser es kommt während des Vortriebs zu Überraschungen. Zu einem Niedersturz etwa. «Dann gehst du mit der Bauleitung rein, die Mineure sind schon am Wuseln und Machen.» Was ist los, ist das Gestein nun stabil oder bricht immer neues Material runter? Die Geologin muss ihren Sinnen vertrauen. «Bröselt es noch, hörst du ein Rieseln?» Durch solche Niederstürze können auch mal 20 Meter hohe Kamine entstehen. «Wenn einzelne, feste Blöcke in einem Mal runterkommen, bleibt es meist dabei. Handelt es sich aber um weiches Feinmaterial und drückt zudem Wasser nach, kann es auch plötzlich weit runterbrechen.» Dann muss die Geologin eine Einschätzung vornehmen, auf deren Grundlage die Bauleitung bestimmt: abwarten, Sicherungsarbeiten vornehmen oder den Vortrieb wieder aufnehmen.
So gefährlich wie zu Zeiten des Baus des ersten Albula-Tunnels, als der Bauplatz noch eigens über ein Krankenhaus und einen Friedhof verfügte, ist der Tunnelbau heute nicht mehr. Aber Unfälle gibt es immer noch. Wenn auch kaum mehr an der Ortsbrust, wie der vorderste Teil eines neuen Tunnels genannt wird. «Heute passieren die meisten Unfälle im rückwärtigen Bereich, bei der Logistik, klassische Baustellenunfälle.»
Von der Sondermülldeponie nach Sedrun
Eine ältere Frau, von der Sonnenbrille bis zu den Schuhen ganz in Schwarz, unterbricht unser Gespräch. «Hend Si Kürbis?» Sie ist an der richtigen Adresse. «Darf ich kurz?» Fünf Minuten später ist die passende Frucht gefunden und verkauft, Anita wieder am Tisch. «Wo waren wir?»
Den Studienabschluss im Rucksack, verschlägt es die frischgebackene Geologin Ende der Neunzigerjahre nach Aarau in ein grösseres Ingenieurbüro, 700 Mitarbeitende. Ihr damaliges Arbeitsfeld: Grundwasser, Altlasten, «klassische Mittellandgeologie eben». Dazu gehört auch die Sanierung von Sondermülldeponien, wo zu unkomplizierteren Zeiten «alles auf einen Haufen geworfen wurde». Um das kontaminierte Deponiewasser aufzufangen, muss eine Abschirmung und eine Drainage her – und dazu will ein Tunnel gebaut werden. Anita fand das «lässig». Bald folgte eine Anfrage der Bürofiliale Thusis, man suchte Leute für einen langjährigen Auftrag in Sedrun. Nächste Haltestelle: neue Alpentransversale NEAT.
Ein Leben im Takt der Maschine
«Die Tunnelwelt ist eine für sich und auch die Leute sind eigen.» Die NEAT-Baustelle verschlingt Anita mit Haut und Haaren und wird sie für sechs Jahre kaum mehr loslassen. Die rund 600 Mineure in Sedrun sind ein Dorf im Dorf. Sie hausen grossteils in einer Barackensiedlung unterhalb der 300-Seelen-Gemein- de; wer es sich leisten will, mietet sich im Dorf eine Bleibe, so auch Anita.
Es ist ein Leben auf der Baustelle, für die Baustelle, getaktet durch den Rhythmus der Sprengungen: Rund um die Uhr wird tief unterhalb Sedrun im Berg gebohrt, gesprengt, geschuttert und gesichert – tags wie auch nachts. Nach der Arbeit in den beiden Stollen 1 und 2 geht es für viele Mineure in den «Stollen 3» – das Dorfpub – und für manche in den «Stollen 4», das Puff. Für die drei im Schichtbetrieb arbeitenden Mann- schaften wird so regelmässig der Tag zur Nacht – und die Nacht zum Tag. Irgendwann dazwischen klingelt Anitas Wecker, nun bricht ihre Tunnelzeit an: Entspricht das Gestein der Prognose? Auch die Geologen haben Schichtbetrieb, auch am Wochenende. Sie wechseln sich im Team ab – meistens drei Tage arbeiten, ein Tag frei, sechs Tage arbeiten und dann vier Tage frei – «oft bin ich dann nach Hause, bei den kurzen Wechseln blieb ich aber meistens oben». Zurück in Zug, kommt sie kurz in Berührung mit dem, was sie früher noch als normales Leben kannte – «ach ja, kurze Hosen, Baden, im T-Shirt abends im Café sitzen, auch noch schön, diese andere Welt...» Aber kaum wieder oben auf der Baustelle, «da bist du wie...» – sie macht ein lautes Schlürfgeräusch und lacht. «Es war eine uuh lässige Zeit», wird sie noch manches Mal sagen.
Ferienmitbringsel: Yak
Ein paar Meter neben uns schnappt Belsi nach einer Fliege. Der Border- Collie-Bergamasker-Mischling weilt während meines Besuchs gerade zur Ferienpflege auf dem Hof. Überhaupt, Hof, Yak, Ziegen – wie ist es dazugekommen?
2007 arbeitet Anita während eines Zwischenjahres das erste Mal auf einer Alp in Appenzell als Hirtin. Und da ist es um sie geschehen. Das Leben in der kleinen verschworenen Gemeinschaft des Alpteams in der rauen Berglandschaft, dazu ein Haufen Rinder und Ziegen, nie zu wissen, was der Tag bringen wird – «es hat mich angefressen».
Mit dem Thema Landwirtschaft in Graubünden kommt Anita über eine Geologiekollegin in Berührung, die während ihrer Zeit an der NEAT-Baustelle zu ihrem Team stösst. Sie beginnt regelmässig auf Bauernhöfen auszuhelfen. Auf einer ihrer Reisen – zu Pferd in der Mongolei unterwegs – lernt Anita Yaks kennen. «Dort sind das die normalen Kühe, ich fand sie cool.» Sie erzählt dem Bauern, bei dem sie aushilft, von den genügsamen und unkomplizierten Kühen. Bald ist es entschieden: «Wir bauen eine Yak-Herde auf!» Gesagt, getan. Die Rinder mit dem dichten, an den Seiten zottig herabhängenden Fell erweisen sich bald als «perfekte Lückenfüller», erzählt Anita. Sie fressen, was die Milchkühe übriglassen, und kommen auch in steilem Gelände sehr gut zurecht.
Als der Bauer seinen Betrieb dem Sohn übergibt, schaut sich Anita nach einem Hof um, um ihre Yak-Herde unterzubringen. Durch Zufall erfährt sie von einem Hof bei Domat/Ems, und wieder geht alles ganz schnell.
Man trifft sich immer wieder
Mineure sind ein Menschenschlag für sich, sagt Anita. Rau im Umgang, grobe Sprüche – gern auch unter der Gürtellinie –, aber auch offen und direkt, und was auch dazugehört: kollegial und hilfsbereit. «Ich mag das.» Wie lebt es sich als Frau in dieser fast reinen Männerwelt? «Am Anfang gab es bei einigen Skepsis», erzählt Anita, «bis sie merken, auch du machst dir die Hände schmutzig und packst an. Und du darfst keine Tussi sein.» Und dann wäre da noch der Aberglaube: Lange hiess es unter Mineuren, Frauen im Tunnel brächten Unglück – mit Ausnahme der Schutzpatronin Barbara natürlich. Angeblich, weil der Berg aus Eifersucht auf die weiblichen Reize unberechenbar werde. Und, nie etwas passiert? «Einmal gab’s einen Einsturz, als ich in den Tunnel kam.» Ein paar dumme Sprüche, klar. Aber echte Vorwürfe, nein. Man hält zusammen. «Tunnelwelt ist eine grosse Familie. Und man trifft sich überall und immer wieder.»
So auch am Albula-Tunnel, wo der bestehende Bahntunnel der Rhätischen Bahn saniert und zum Sicherheitsstollen umfunktioniert wird; parallel wird ein neuer Tunnel gebaut, 2018 war Durchstich. Anita ist nebst der geologischen Begleitung der Tunnelarbeiten auch mit der Materialbewirtschaftung betraut. Rund 240’000 Kubikmeter Ausbruchmaterial wollen nach Verwendbarkeit sortiert, deponiert oder weiterverarbeitet werden. Es ist im Vergleich zur NEAT eine kleinere Baustelle, rund 300 Leute, und sie wohnt auch nicht dort, ihr Büro liegt im nahen Thusis. Es ist aber ebenfalls ein faszinierendes Projekt mit sehr unterschiedlicher und zum Teil anspruchsvoller Geologie, wie Anita sagt. Aktuell läuft der Innenausbau des Tunnels. Im Tunnel ist sie heute allerdings nur noch selten. «Früher, als ich jünger und billiger war, war ich oft im Stollen. Nun dürfen meine jungen Kollegen in den Untergrund – darunter auch eine Frau.» Anita geht derweil nur noch zur Kontrolle in die Tunnels, arbeitet ansonsten im Büro.
↑ Die heilige Barbara wacht als Schutzpatronin über den Berg- und Tunnelbau. Kaum Zeit für Stahlberger und Rammstein
Auf Anitas Hof nähert sich die Sonne langsam dem Zenit. «Es ist schon ein ziemlicher Spagat, das alles unter einen Hut zu kriegen», sagt sie. Drei Tage die Woche ist sie als Geologin im Büro, sonst auf dem Bauernhof. «Es ist viel Arbeit, aber es macht Spass.» Wenn es mal Freizeit gibt, geht sie gerne in die Berge oder auch mal an ein Konzert – ob nun Stahlberger oder Rammstein. In einem Jahr will sie mit ihrem Hof Zwischenbilanz ziehen, sehen, ob er sich selbst trägt, «oder ob ich als Geologin den Hof querfinanzieren muss». Ein Preis, den Anita wohl zu zahlen bereit wäre, um zu arbeiten, wo es ihr am besten gefällt: draussen, wo man sich die Hände noch schmutzig machen kann.
↑ Am Ende muss die Geologin eine Annahme treffen. Darauf stützen die Ingenieure ihre Entscheidungen: welche Sicherungsklasse ist nötig, welcher Vortrieb wird gewählt, Sprengung oder Tunnelbohrmaschine? Text: Gion-Mattias Durband | Bild: Mayk Wendt