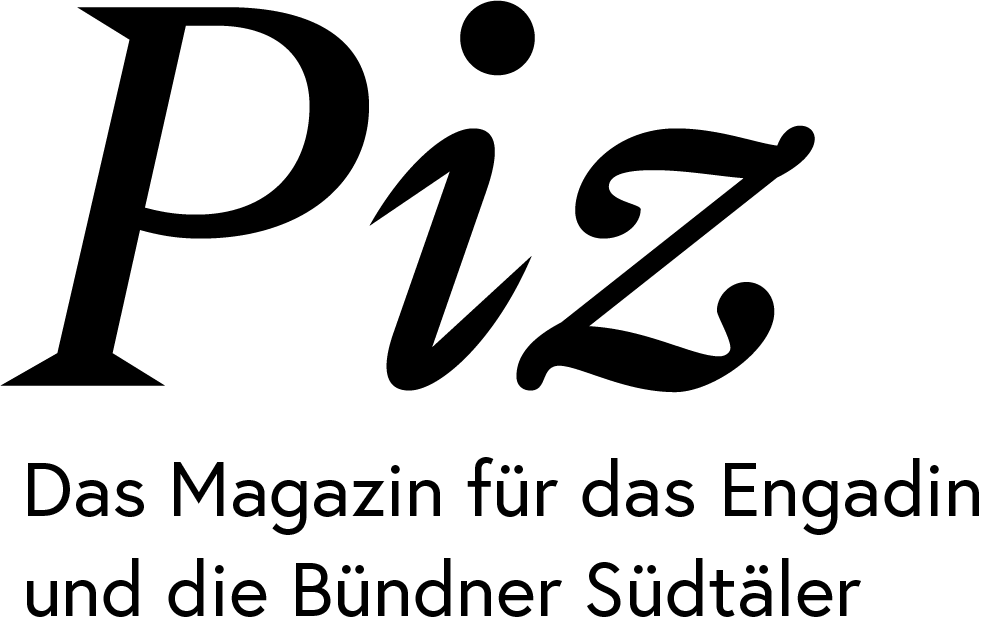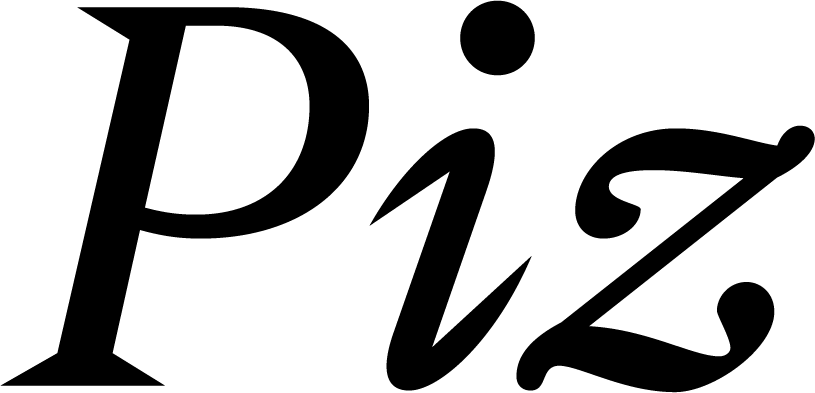Im Schatten der Gipfel – Menschen im Einsatz für andere
Was für Menschen sind Bergretter, was treibt sie an, wie gehen sie an schwierige Einsätze heran, wie verarbeiten sie Tragödien? Einer, der seit Jahrzehnten am Berg hilft, ist der Samedner Dominik Hunziker, Rettungschef des SAC Bernina. Auch Peter-Christian Müller, Pilot aus Leidenschaft, will helfen. Der St. Moritzer leitet die Rega-Einsatzbasis in Samedan. Rico Dürst aus Malans ist durch seine Erfahrungen am Berg zum Erfinder geworden. Und dann ist da noch Yuna.
Er ist ein Bergretter, wie er im Buch steht, und nicht einer aus der gleichnamigen TV-Serie. Denn diese sei nicht realistisch. Dominik Hunziker weiss wie kaum ein anderer, was Realität am Berg ist. 28 Jahre lang war der heute 62-Jährige als Rettungsspezialist des SAC Bernina mit der Rega unterwegs. Seit drei Jahren ist er Rettungschef des SAC Bernina. «Bergretter ist kein offizieller Beruf, wir stehen im Erwerbsleben und retten nebenbei», sagt der gelernte Elektriker, der auch eine Bergführerausbildung gemacht hat und seit 22 Jahren als Sicherheitsfachmann unter anderem Bergretter ausbildet.
Verantwortlich für die Bergrettung ist die jeweilige Sektion des SAC für ihre Region. Der SAC Bernina unterhält sechs Rettungsstationen (Pontresina, Samedan, Zuoz, Poschiavo, Sils und Maloja) und ist zuständig für die terrestrische Rettung im alpinen und schwer zugänglichen Gelände. Das Gebiet ist über 1000 Quadratkilometer gross und liegt auf einer Höhe von 522 bis 4049 Meter über Meer. Die rund 100 Retter sind freiwillig und ehrenamtlich rund um die Uhr einsatzbereit. «Für die Einsätze sind wir bezahlt, für die Wartezeit nicht», erklärt Hunziker. Neue Retter fänden sich genug, hingegen sei es schwieriger geworden, Fachspezialisten bei der Stange zu halten. Irgendwann gehen Beruf und Familie vor, was er verstehen könne, ergänzt er. Hunziker mag Technik, aber nicht um ihrer selbst willen, sie soll dem Menschen dienen.
Respekt und Wertschätzung am Berg
Überhaupt steht für ihn der Mensch im Zentrum. Um ihm zu helfen, ist der Bergler aus Samedan unterwegs. In Hunderten von Einsätzen hat er Erfahrungen gesammelt. Er sagt geradeheraus, was Sache ist, aber immer auf Augenhöhe und mit Respekt, und er nimmt sein Gegenüber ernst. «Auch bei einem einfachen Einsatz, wo manch einer sagen könnte, dafür hätte man uns nicht alarmieren müssen.» Er erzählt von einer Frau, die sich nicht traute, über eine vom Schnee blockierte Brücke zu klettern. «Die Frau hatte ein Problem und wir haben geholfen. Jeder Mensch hat seine Grenzen auf anderer Höhe, das muss man akzeptieren.»
Die grösste Herausforderung in der Bergrettung ist für Hunziker die Wertschätzung der Arbeit der nicht hauptberuflich tätigen Retter. «Wir haben nie Feierabend, wenn es uns braucht, sind wir da, auch an Wochenenden und Festtagen.» Das Verhältnis professioneller Retter zu ihrem Beruf mit Feierabend sei da etwas anders. Professionelle Kollegen und Institutionen seien sich des Einsatzes der nebenberuflichen Retter vielleicht zu wenig bewusst. Obwohl Hunziker ein Mensch mit Prinzipien und Ansprüchen ist, oder vielleicht gerade deswegen, hat er viel Verständnis für die Menschen. Dass Gerettete sehr selten Danke sagen, kann er verstehen. «Wir stehen am Anfang eines langen Prozesses, ein Trauma zu überwinden. Die Verunfallten sind dankbar für die Pflegenden, die täglich an ihrem Spitalbett stehen, wenn sie die Augen aufschlagen. Sie sind die stillen Helden», sagt er.
Hunzikers Lohn ist, nebst dem Einsatzgeld, wenn er helfen konnte. Und sei es einen Toten der Familie heimzubringen. Am Piz Palü musste er vor Jahren am frühen Morgen ausrücken, um zwei Personen aus einer Randspalte zu retten. Das Nebelmeer war dicht, das Ausfliegen schwierig. Der Pilot durchbrach die Nebeldecke und flog zur Unfallstelle. Er sagte zu Hunziker, er könne ihn absetzen, aber dann sei er allein. Die Bedingungen erlaubten nicht zurückzufliegen, um weitere Hilfe zu holen. Hunziker stieg aus. Am Unfallort traf er auf zwei unbekannte Bergsteiger, die Hilfe anboten. Es galt, allein bei schwierigen Bedingungen mit unbekannten Helfern zu entscheiden, was zu tun war. Die Rettung gelang. Der abgestürzte Mann konnte über die Passhöhe mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden. Die abgestürzte Frau war tot. Hunziker wartete neben ihr, bis das Wetter den Ausflug erlaubte. Ein Moment des Innehaltens, auch heute noch, im Gedenken an die Frau und ihre Familie.
Was braucht ein Mensch, um täglich für solche Einsätze bereit zu sein? Hunzikers Antwort kommt schnell: «Im Kopf muss es stimmen.»
Retter aus der Luft
Die psychischen Belastungen eines Bergretters kennt auch Peter-Christian Müller, Leiter der Rega-Einsatzbasis Samedan. «Helden sind wir nicht, unser Beruf ist zu helfen, auch unter schwierigen Bedingungen», sagt er. Müller ist Pilot, das wollte er schon immer werden, und man glaubt es ihm sofort. Fokussiert, konzentriert kommt er bei allen Fragen auf den Punkt. Nach einer Ausbildung beim Militär flog er für die Armee Helikopter und nach einigen Jahren als Linienpilot bei der Swiss wurde er heim ins Engadin geholt. Müller, oder Mulo, wie er seit seiner Zeit im Militär genannt wird, ist in St. Moritz aufgewachsen und auch seine Frau ist aus dem Engadin. Als er vor zehn Jahren das Angebot erhielt, in der Rega-Einsatzbasis in Samedan anzufangen, hat er zugesagt und es nie bereut.
Seit zwei Jahren leitet der 47-Jährige die Basis. Eine wichtige Aufgabe, wahrscheinlich die wichtigste für einen Piloten, ist das Entscheiden, ob geflogen und damit gerettet wird. «Grundlage ist das Wetter, Grenze die Sicherheit der Crew», sagt Müller. Eine Alternative zum Fliegen sind die terrestrischen Bergretter der Alpinen Rettung Schweiz, die zwar länger unterwegs sind, aber auch bei Schlechtwetter starten können. Rega und Alpine Rettung stehen in solchen Situationen in ständigem Kontakt. Bei einem Heli-Einsatz ist die Crew zu dritt oder viert unterwegs. Der Pilot ist der Commander (CDR), gemeinsam im Einsatz mit ihm stehen ein Rettungssanitäter und ein Arzt, je nach Einsatz kommt ein Rettungsspezialist der Alpinen Rettung Schweiz dazu.
«In jungen Jahren ist es schwieriger, mit dem Druck des Entscheidenmüssens umzugehen, mit der Erfahrung wird es leichter», sagt Müller. «Am schwierigsten ist es, wenn ich mitten in der Nacht geweckt werde, es ist Sturm und ich weiss, da draussen braucht jemand Hilfe», sagt er. Die Erfahrung hilft und auch die technischen Hilfsmittel wie Nachtsichtgeräte oder immer präzisere Wetterprognosen. Das Wetter ist in letzter Zeit unberechenbarer geworden, die Winde stärker oder sie bringen öfter Saharastaub mit, der die Sicht behindert. Fliegen in den Bergen ist ausserdem anspruchsvoll, weil mit zunehmender Höhe die Luft dünner wird und damit die Motorenleistung geringer. Der Effekt wird im Sommer, bei höheren Temperaturen und grösserer Luftfeuchtigkeit, verstärkt.
Die Rega-Crew in Samedan hat bis Anfang April 2025 280 Einsätze geflogen, 2024 waren es insgesamt 700. Die Entscheidfindung wird mit der Erfahrung leichter, der Umgang mit einer nicht möglichen Rettung oder mit einem Toten nicht. «Man muss lernen, damit umzugehen», sagt Müller. Seine Arbeit ist es zu helfen. «Wir helfen allen, wir urteilen nicht.» Berggänger, die sich überschätzen oder die Natur unterschätzen, müssen unter Umständen die Rettung zahlen, sofern sie nicht Rega-Gönner sind. «Aber danach fragen wir nicht und das entscheiden wir nicht, das ist nicht unsere Aufgabe.»
Etwas will er den Berggängerinnen und Berggängern mitgeben: Wer auf den Heli wartet, soll sich zu erkennen geben und mit erhobenen Armen und dem Körper ein Y formen. Und unbedingt alle losen Gegenstände vom Landeplatz des Helis entfernen, damit sie nicht herumfliegen und den Heli oder gar Personen gefährden.
Der Mensch werde auch in Zukunft entscheidend für eine sichere Rettung sein, ist Müller überzeugt, wobei er auf die Unterstützung aller möglichen technischen Hilfsmittel angewiesen sei. Und: «Der Entscheid, ob geflogen wird, wird immer die Herausforderung des Piloten bleiben.»
Sichtbarkeit für den Piloten
Rico Dürst, der von sich sagt, ohne Berg gibt es mich nicht, ist in den Bergen zum Erfinder geworden. Er war als Flughelfer unterwegs, um verletzte Tiere zu bergen. «Die Rettung beginnt mit der Sichtbarkeit», sagt er. Oft sei es schwierig, Tiere oder Personen zu finden, wenn die Ortsbezeichnung nur vage sei und keine exakte Ortung stattfinden könne. Ein Farbtupfer, ein Ballon wäre die Lösung, dachte Dürst, und die Idee liess ihn nicht mehr los. Das ist sechzehn Jahre her. Heute kann man diesen Ballon kaufen, er heisst «AirMarker» und seine Geburt war um einiges komplexer, als Dürst dachte. Das «Kind» ist 890 g schwer, 25 cm hoch, gefüllt mit drei Heliumpatronen von je 63 ml und 230 bar Druck, um den Ballon zu füllen, fliegt gut drei Tage und kostet 199 Franken. Zusätzlich schaltet sich ein LED-Licht ab 10 Lux ein und ab 20 wieder aus.
Am Anfang standen Machbarkeit und Marktanalyse. Als feststand, dass es nichts dergleichen gibt und es machbar ist, gründete Dürst zusammen mit Daniel Wattenhofer eine Firma, die heute im Malanser Industriequartier zu Hause ist. Es galt Namen zu finden, Patente anzumelden und unendlich viel zu testen, denn «das Ding muss zu 100 Prozent funktionieren», so Dürst. Getestet wurde unter anderem im Zürcher Staatswald oder mit der österreichischen Alpenpolizei. Heute funktioniert der Rettungsballon, ist Dürst überzeugt. Denn obwohl über 2000 Stück verkauft wurden, kam er im Ernstfall noch nie zum Einsatz.
«Während Rettungsorganisationen und öffentliche Institutionen interessiert sind, tut sich der private Berggänger schwer mit einem zusätzlichen Gerät im Rucksack», sagt Dürst. Weshalb? «Häufigste Antwort: Mir passiert schon nichts.» Während die Gefahren im Winter besser bekannt und anerkannt seien, unterschätze man sie im Sommer, sagt Dürst. Nebst dem Wetter, dem Klima und der Ausrüstung ist für Dürst der Mensch die Herausforderung am Berg, das heisst dessen Selbsteinschätzung.
Dass Dürst sein Projekt auch über Durststrecken ans Ziel führen konnte, verdankt er zwei Eigenschaften, die für Bergler genauso unabdingbar sind wie für Unternehmer: Durchhaltewillen und die Bereitschaft zu scheitern.
Und zum Schluss
Mensch und Technik sind ein gutes Team. Für Sonja Sonderer vom SKBS OG Graubünden gibt es ein noch besseres: sie und Yuna, ihre neunjährige Labrador-Retriever-Hündin. Die beiden haben im März die Schweizer Meisterschaft Lawinenhunde im Engadin gewonnen. «Der Titel gehört uns beiden», sagt Sonja Sonderer, «nach so vielen gemeinsamen Jahren haben wir eine intensive, tiefe Beziehung. Man könnte sagen, wir verstehen uns meist blind.» Aber es steckt auch viel Arbeit dahinter, die beiden trainieren im Winter fast jedes Wochenende. Yuna habe noch niemanden aus der Lawine gerettet, aber als Personenspürhund bei der Polizei, wofür sie auch ausgebildet sei, letzten November im Misox in einer kalten Nacht einen 86-jährigen Rentner gefunden, dem sie möglicherweise das Leben gerettet habe. Dass der Hund in Zukunft durch Roboter ersetzt wird, ist kein Thema für Sonderer: «Niemals! Kein Roboter kann die hervorragende Nase unserer Vierbeiner ersetzen.» Sie wir nicht die Einzige sein, die glaubt, dass die künstliche Intelligenz an der Herausforderung, die Spürnase des Hundes zu kopieren, scheitert.
Text: Barbara Esther Siegrist
Bild: Mayk Wendt